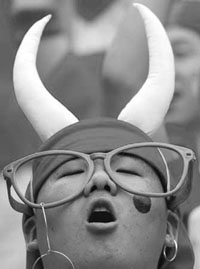Fußball in Asien - Teil 4 Ostasien
Ca. 2500 Jahren v. Christus wurde in China ein bereits ein Ballspiel namens
Zuquiu betrieben, das dem heutigen Fußball ähnlich ist. Dieses
Spiel starb jedoch über die Jahrtausende regelrecht aus. Später
entstand das legendäre Kemari, über das an dieser Stelle schon
berichtet wurde. Der Ursprung des Fußballs scheint also eigentlich
aus Ostasien zu kommen. Es gab jedoch keine geradlinige Entwicklung zum
heutigen Spiel.
Der heutige Fußball kam nämlich, wie nicht anders zu erwarten, übers
Meer - durch die Briten - in die großen Hafenstädte Chinas (Shanghai,
Hongkong). Einer der ersten Orte Asiens, wo sich der Rasensport zuerst etablierte
war Hongkong. Hier waren es in den 70ern des 19.Jahrhunderts (!!!) vorwiegend
englische Seeleute, Soldaten und Missionare, die dem runden Leder nachjagten
und anfang des letzten Jahrhunderts erste Meisterschaften austrugen. Nach
und nach verbreitete sich das Spiel dann unter Chinesischen Studenten, die
an Britischen Schulen studierten. Eine “richtige” Meisterschaft
wird jedoch erst seit 1945 ausgespielt. Interessant der Modus: Ähnlich
wie beim Eishockey spielen die 8 Teams der Liga zuerst eine Vorrunde aus.
Die ersten Vier treffen dann in der Finalrunde erneut aufeinander, allerdings
werden ihnen die Hälfte der Punkte und Tore aus der Vorrunde dabei
angerechnet.
Das erfolgreichste Team ist seit Jahrzehnten “South China”,
die 9 x vor 1945 und 27 x danach den Meistertitel holten. In den letzten
drei Jahren waren es aber die Konkurrenten “Happy Valley” und “Sun
Hei”, die den Titelkampf unter sich entschieden.
Die Ausbreitung des SARS-Virus verhinderte zuletzt für ein Vierteljahr
den Spielbetrieb in Hongkong und China. Allein diese Zeit reichte in China
aus, um die Chinesen nach Fußball süchtig zu machen. So stieg
das Zuschauerinteresse nach SARS um 30 % an.
Doch der Weg zum heutigen Volkssport Nummer Eins war lang und beschwerlich.
Nach dem Sturz des Kaisers und dem Ausrufen der Republik entstand 1912 das
erste Nationalteam. Zu der Zeit gab es auch die ersten fußballerischen
Vergleiche im Rahmen von “Nationalen Spielen” unter Vertretern
verschiedener Regionen des Landes.
Japanische Okkupation und Krieg (31-49) und später eine von Mao Tse
Tung vorangetriebene Isolation des Landes, verhinderten dann lange eine
Entfaltung des Ballzaubers. Anfang der 50er Jahre wurden zwar die ersten
Landesmeisterschaften ausgespielt. Doch die Mannschaften waren dabei erneut
Vertreter einzelner Landesteile (Nord, Süd und Ostchina), sowie Teams
staatlicher Inmstitutionen (Armee, Polizei, Eisenbahn).
In den Jahren der kulturellen Revolution 1967-1971 fand dann gar kein Ligafußball
statt. Aber auch danach war Fußball bei der Kommunistischen Partei nicht “der
Sport”. Das änderte sich erst unter Deng Xiaoping. Er öffnete
das Land für die internationale Wirtschaft und machte somit auch den Weg
frei für eine leistungsorientierte Entwicklung des Fußballs. Mittlerweile
sind neun Jahre vergangen, seit die KP eine Profiliga mit marktwirtschaftlichem
Treiben erlaubte. Etliche Vereinsfunktionäre müssen aber fortwährend
in öden Sitzungen die Gedanken des Genossen Generalsekretär Jiang Zemin
studieren. Sieben Aktive, jubelte z.B. der Tianjiner Profiverein “Tianjin
Teda CEC” kürzlich, seien dort in die KP eingetreten (...)
Dabei haben die Chinesen eigentlich ganz andere Probleme: Bestechliche Schiedsrichter,
Spielabsprachen und randalierende Fans bestimmen nämlich inzwischen das
Geschehen. Dabei bedingt das eine durchaus das andere, denn erst seit öffentlich
bekannt wurde, dass sich Referees schmieren lassen und Vereine untereinander
vorher Absprachen treffen, lassen die Fans (landesweit redet man von knapp 400
Millionen Begeisterten) ihrem Frust auch physisch freien Lauf. Z.B. im letzten
Jahr beim Erstliga-Match Shaanxi Guoli gegen Tabellenführer Quingdo Yizhong.
Nachdem der Schiri in der Nachspielzeit einen Elfmeter für den Spitzenreiter
pfiff, den der Gast auch prompt zum 3:3-Endstand nutzte, brannten dann nicht
nur Polizeiwagen und Stadionsitze, auch der "Unparteiische" bekam was
auf den Kopf und wurde in Sprechchören der Korruption bezichtigt. Die Gästemannschaft
schließlich flüchtete in einem Hagel von diversen Gegenständen
in die Kabinen - Fußball 2002 in China. Das scheint kaum verwunderlich,
denn während die Spieler für chinesische Verhältnisse enorme Gehälter
verdienen, müssen sich die Schiris pro Match mit rund 1000 Yuan (ca. 125
Euro) begnügen. Hinzu kommt, dass auf die von chinesischen Unternehmen finanzierten
Teams über illegale Buchmacher inzwischen Millionensummen gewettet werden
- eine Einladung zum Verschieben von Spielen. "Schlimmer als die Mafia",
wie ein chinesischer Sportfunktionär kürzlich einräumte.
"
Fußball hat in China keine Tradition", sagt Bora Milutinovic, der
für drei Millionen Dollar inklusive Werbeeinnahmen die Nationalkicker zur
WM 2002 führte. Dem Land fehlt es an einer Vereinskultur mit Amateuren.
Freizeitkicker finden sich nur in Betrieben oder Universitäten. Clubs wechseln
sogar den Standort, wenn das Umfeld nicht mehr stimmt. Die von einem Handy-Unternehmen
finanzierte Mannschaft Liaoning Bird z.B. zog jüngst nach Peking um, weil
in dem von sozialer Not heimgesuchten Stahl- und Kohlerevier in der Nordostprovinz
Liaoning der Absatz von Mobiltelefonen ausgereizt war.
In den letzten Jahren wird China auch für westliche Auslaufmodelle interessant.
Aktuelle Beispiele Jörg Albertz (Shanghai Shenghua), Stepanovic und Ratinho
(Shengyang Jinde), Stig Töfting (Tjanjin Teda), Rachid Azzouzi (Chonqing
Lifan) oder ein Paul Gasgoigne, der im letzten Jahr ein Angebot von St. Pauli
ausschlug, um zu Gansu Tianma in die 2.Chinesische Liga zu wechseln. Allerdings
nutzte Gazza die SARS-Pause, um sich in Arizona einer Erziehungskur zu unterziehen,
von der er nicht zurückkehrte (und es wohl auch nicht vorhat).
Einer, der den Grundstein für den heutigen Profisport in China gelegt hat,
ist der ehem. Bundeligatrainer Klaus Schappner. Von 92 bis 94 coachte er das
Nationalteam und gilt noch heute als Volksheld. Es soll sogar ein Bier mit seinem
Konterfei gegeben haben. Arie Haan, aktueller Trainer der Auswahlmannschaft hat
diesen Status noch nicht erlangt. Dennoch kann er optimistisch in die Zukunft
schauen. Die Nachfrage an Chinesischen Spielern im Ausland ist seit der letzten
WM noch gestiegen, viele Profis sammeln jetzt in Europa Erfahrungen, die sie
dann in die Nationalelf einbringen können. Kannte man früher nur Cheng
Yang (Frankfurt, St.Pauli), so folgte zuletzt Jiayi Shao (1860) in die Bundesliga.
Und auch auf der Insel wurde man fündig und verpflichtete mit Lie Tie und
Sun Jihai zwei Topspieler. Lie Tie spielte zuletzt beim FC Everton und ist in
China populärer als Beckham. Dank ihm wurde Everton zum beliebtesten englischen
Club in China. Die chines. Homepage des FCE wurde täglich von über
500.000 Fans aufgerufen. Das Spiel Everton - Manchster City (mit Sun Jihai) verfolgten
Anfang des Jahres 350.000 Zuschauer vor Chinas Fernsehern. Davon können
andere Verein nur träumen. Den erfolgreichsten Fußball Chinas spielen
allerdings immernoch die Damen. Seit 1986 werden sie regelmäßig Asienmeister,
sie waren Vizeweltmeister und Olympiazweiter.
Unterschiedliche Entwicklung hingegen in Macau und Taiwan. In Macao waren es
die fußballbegeisterten Portugiesen, die Anfang des 20. Jhd. dort landeten
und gegen das runde Leder traten. Lange Zeit hemmten aber die kulturellen Unterschiede
zwischen den Kolonialherren aus Portugal und der chinesischen Bevölkerung
den Ausbruch des Fußballfiebers. Erstmals wurde wohl in den 70ern eine
Meisterschaft ausgetragen. Mindestens seit den Achtzigern wird die Liga regelmäßig
gespielt, die Infos über Macau sind leider sehr bescheiden.
Die erste Liga setzt sich aus 8 Teams zusammen, die zwischen November und April
den Titel ausspielen. Champion der letzten beiden Jahre ist ein Team namens “Monte
Carlo”. Zu den weiteren Topteams zählen “Lam Pak” und “Policia”,
vermutlich eine Abordnung der örtlichen Streife. 1999 wurde Macau von Portugal
an China zurückgegeben, durfte allerdings den Autonomie-Status behalten.
Die fußballtechnisch unbedeutende Stadt versucht seither, den portugiesischen
Einfluß abzulegen und eine eigene Identität zu finden. Gegen die Teilnahme
von Macau - Clubs in der Chinessischen Liga sprach sich der Präsident des
Macauiaschen Verbands klar aus. Selbstständigkeit geht derzeit noch vor
sportlicher Entwicklung.... Das Verhältnis von Macau zum “roten” China
bleibt so weiter angespannt. Zu Feierlichkeit der Rückgabe Macaus fand ein
Spiel: “Macau - China” statt, bei dem Altstars wie Klinsmann, Dunga
und Baresi für Macau aufdribbelten. China gewann dennoch 4:0. Der Japaner
Eiji Ueda soll nun den Fußball Macaus voranbringen. Aus dem bisherigen
Amateurstatus sollen die Fußballer langsam in den halbprofessionellen Bereich
gelangen. Damit man hoffentlich den derzeitigen FIFA-Platz Nr. 186 bald verlassen
kann.
Auf der Insel Taiwan gehörte Fußball noch nie zu den beliebtesten
Sportarten. Seit der Abtrennung von China unterliegen die Taiwanesen dem Einfluß der
US-Amerikaner, die vor allem Base- und Basketball vorantreiben. Zudem wurde die
fußballerische Entwicklung durch den vorübergehenden Ausschluß Taiwans
(von 76 - 89) vom AFC (Asiatischer Fußball Vereinigung) stark gebremst.
Die 8-Teams-starke Liga wird seit 20 Jahren ausgetragen und von Vereinen der
Hauptstadt Taipei beherrscht. Allen voran “Taipower” Taipei, die
seit 1994 den “BFC Taiwans” darstellen, soll heißen Serienmeister
des fernen Ostens.
Die Besatzung des Britischen Kriegsschiffs “Flying Fish” brachte
im Jahre 1882 den “Soccer” nach Pusang in Korea. 1904 wurde der Ballsport
an der königlichen Fremdsprachenschule in den Lehrplan aufgenommen. Erste
Wettbewerbe wurden aber erst unter der Japanischen Kolonialherrschaft in den
Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts ausgetragen. Fußball entwickelte
sich zwar damals schon zu einer Art Breitensport, doch konnten sich die Koreaner
unter der Japanischen Okkupation (1910-1945) nicht wirklich entfalten. Nach Ende
des Krieges wurde Korea in eine sowjetisch und eine amerikanisch beeinflußte
Zone geteilt. Im Süden entstand 1948 die Republik Südkorea, wo im selben
Jahr die KFA (Korean Football Association) gegründet wurde. Dank einer schnellen
Entwicklung gehört Südkorea bereits seit den 50ern zur Asiatischen
Fußballspitze. 1954 nahm man noch relativ erfolglos an der WM in der Schweiz
(0:9 gegen Ungarn, 0:7 gegen Türkei) teil, 56 und 60 gewann man hingegen
die ersten Asienmeisterschaften. Seit 1986 ist Südkorea regelmäßig
bei jeder WM vertreten. Größter Erfolg der “Tiger” - wie
die Südkoreanischen Fußballer genannt werden - das WM-Halbfinale 2002
gegen Deutschland.
Ligafußball selbst wird in Südkorea erst seit 1983 gespielt. Anfangs
nur mit fünf Mannschaften, wurde die Super-League 1987 auf 10 Teams aufgestockt.
Sie gilt als die erste Profiliga von ganz Asien. 1994 in K-League umbenannt entwickelte
sie sich zu einer der stärksten Ligen Asiens, die südkoreanischen Vertreter
konnten schon fünf Mal den Asiatischen Cup der Landesmeister gewinnen, das
Team Chonbuk Hyundai Motors unterlag in diesem Jahr erst im Finale der neugeschaffenen
Champions League dem Meister Saudi Arabiens Al Hilal.
Die letzten beiden Meisterschaften sicherte sich die Mannschaft Seongnam Ilhwa
Chonma (Pegasus). Sie ist ohne Frage das erfolgreichste Team des Landes. Ungewöhnlich,
das die Teams aus der Hauptstadt Seoul überhaupt keine Rolle in der Meisterschaft
spielen, dafür eher Küstenmannschaften aus Pusang (Icons), Pohang (Steelers)
oder Suwon (Samsung Blue Wings). Zu den populärsten Spielern des Landes
gehört Bum Kun Cha (78 - 89 für Darmstadt, Frankfurt und Leverkusen
in der Bundesliga; insgesamt 308 Spiele, 98 Tore). Heutige Stars sind Tae-Uk
Choi, Sun-Hong Hwang, Sang-Chul Yoo, aber auch die “alten” Ji-Sung
Park und Yong-Soo Choi, die in Japans J-League ihren Reis verdienen. In Europa
kennt man Seol Ki Hyeon vom RSC Anderlecht, Ahn Jung Hwan (AC Perugia) oder San
Sebastians letzten Coup, den “Beckham Südkoreas” Lee Chun Soo.
In der Bundesliga spielt mit Du-Ri Cha derzeit ein Koreaner bei Eintracht Frankfurt.
Ü
ber die Verbreitung und Entwicklung des Fußballs in Nordkorea ist relativ
wenig bekannt. Die kommunistische Regierung bestimmt die Informationspolitik
des Landes, so gibt es z.B. für Privatpersonen keinen Zugang zum Internet.
Die Hauptstadt Pjöngjang gilt als Zentrum des Fußballs, das dortige
Stadion “1.Mai” faßt 150.000 Zuschauer und galt lange als größtes
Stadion der Welt. Der größte sportliche Erfolg liegt allerdings etwas
zurück - 1966 nahmen die Nordkoreaner bei der WM in England teil, bezwangen
dort spektakulär die Italiener mit 1:0. Pak Doo Ik wurde daraufhin zum Volksheld.
Das folgende Viertelfinale gegen Potugal wurde nach einer 3:0 Führung dennoch
mit 3:5 verloren. Der portugiesische Überspieler Eusebio ließ den
kleinen Nordkoreanern keine Chance und schoß allein vier der fünf
Tore. Für zehn Tage flackerte die Brillanz eines unbekannten Teams über
den Sporthimmel der Welt, um ebenso plötzlich wie sie aufgeflammt war, wieder
zu erlöschen. Danach kursierten nur noch Gerüchte. Ein zorniger Kim
Il Sung habe die Spieler bei der Heimkehr verhaften lassen, weil sie nach ihrem
Sieg etwas zu ausgelassen mit Damen und Ale, Stout oder Guiness gefeiert hätten.
Einige seien in den eiskalten Gulags gestorben.
Nordkorea aber hat nicht einmal an den Qualifikationsrunden zu den letzten beiden
WMs teilgenommen - ob aus Mangel an talentierten Spielern oder aus politischen
Erwägungen des neuen Großen Führers Kim Jong Il ist dabei unklar.
Der Präsident erhofft sich anscheinend mehr von der Frauen - Nationalmannschaft,
die als amtierende Asienmeisterin bei der derzeitigen WM in den USA startet.
Ü
ber 100 Jahre ist es her, dass der Fußball ins Mutterland unseres Lieblings
Yuzuru Okuyama, nach Japan fand. 1873 waren es wiedermal englische Offiziere,
die den Sport an der Marineakademie von Tokio lehrten. 1921 wurde der Fußballverband
gegründet, im selben Jahr fand erstmals der Kaiserpokal statt. Doch bis
Fußball Hysterien im Land der aufgehenden Sonne auslösen sollte, gingen
noch etliche Jahre ins Land. Im Schatten der Sportart Nr. 1 - dem Baseball -
kamen japanische Fußballer nur zu gelegentlichen Erfolgen wie dem Sieg
gegen Schweden bei der Olympiade 36. Ligafußball wurde 1965 eingeführt,
dort spielten aber nur sogenannte Werkteams, die ihre “Amateure” halbtags
dafür freistellten.
Den ersten Sprung machten die Japaner unter dem deutschen Trainer Dettmar Cramer
(Bayern, Frankfurt, Leverkusen), der die Elf von 1960 bis 63 betreute. Auf seine
Anregung hin entstand die Japan Super League nach dem Vorbild der Bundesliga.
Seit 93 gibt es die J-League, mit deren Beginn die Vereine sich größtenteils
von der Tradition als Werkself verabschiedeten. Japanische Teams sind seither
normale Städtevertretungen mit mehreren Sponsoren. Das erleichterte der
Bevölkerung, sich mit den Teams zu identifizieren. Der Beginn der J-League
löste damals einen erneuten Boom aus; Spieler wie Zico (jetzt Japans Nationalcoach),
Buchwald oder Litti San brachten einen Hauch von Weltfußball nach Nippon.
Seit der Qualifikation für france 98 ist Japan-Soccer ganz schwer im Kommen,
wie auch die Begeisterung bei der letzten WM gezeigt hat. Zudem ist Japan amtierender
Asienmeister. Kannte man früher nur Yasuhiku Okudera, 234 BL-Spiele für
Köln und Bremen (26 Tore), so sind es heutzutage neben Hidetoshi Nakata,
dessen Marktwert im achtstelligen Bereich liegt, Spieler wie Inamoto (Fulham),
Ono (Feyenoord), Takahara (HSV) u.a. die Mädchen- und Fanherzen höher
schlagen lassen. Clevere europäische Manager rechnen neben dem zusätzlichen
Absatz von Fanartikeln in Asien mit weiteren Sponsoren aus dem asiatischen Bereich.
Japans Vereinsteams, wie Shimuzu S-Pulse, Kashima Antlers oder Uruwa Red Diamonds
zählen neben den Vertretern Südkoreas zu den spieltechnisch stärksten.
4 x gewannen Japaner den Asiatischen Cup der Landesmeister.
Abschließend noch ein paar Sätze über die unbekannte Mongolei.
Dort in den Steppen sind Ringkampf und Pferderennen bessere Straßenfeger
als Fußball. Die Sowjets (endlich mal nicht die Engländer) hatten
zwar in den 50er Jahren für die erste Verbreitungen von “igratch futbol” gesorgt,
doch der Kampf auf dem Rasen spielt sich fast ausschließlich in der Hauptstadt
Ulan Bator ab.
1999 war ein besonderes Jahr für die Mongolischen Fußballer. Im 40.
Jahr des Bestehens ihres Fußballverbandes wurde die Mongolei Mitglied im
AFC und in der FIFA. Erstmals wurde so der Kontakt zur restlichen Fußballwelt
geknüpft, denn bis dato gab es nur gelegentliche Vergleiche mit den Nachbarstaaten
China und Rußland. MOFF-General Secretary Ganbold Buyannemeh dazu: ”Man
kann sich nicht vorstellen, was das für unsere Spieler bedeutet. Sie reisen
in andere Länder, von denen die meisten Mongolen nur träumen.”
Obwohl Länder wie Südkorea und Japan dort ordentlich investieren, hat
die Mongolei hohe Staatsschulden. Leider fällt nichts davon für den
Bau von Stadion, für Spielerkleidung oder Reisekosten ab. Da können
Teams wie die bekannteste mongolische Mannschaft “ERCHIM” froh sein,
das sie mit Konica überhaupt einen Sponsor haben. “Der Fußball
ist noch nicht so populär, um regelmäßig im Fernsehen gezeigt
zu werden. Deswegen sind mögliche Sposoren noch sehr zurückhaltend”,
so Ganbold.
Neben dem fehlenden Finanzen ist die fehlende Zeit ein großes Problem.
Denn lange kalte Wintermonate mit bis zu minus 50 Grad lassen kaum Spiel oder
Training zu. Rauhe Nordwinde brennen dann von Sibirien kommend im Gesicht und
Schnee bedeckt die Steppe. Während dieser Zeit verlangsamt sich das Leben
bis zum Stillstand. Nur gelegentlich ist es für wenige möglich in der
Halle zu spielen.
Ganbold ist sich sicher, dass es im Land viele Talente gäbe, doch ist zum
einen das Verkehrsnetz katastrophal (außerhalb von Ulan Bator ist das Pferd
das Hauptfortbewegungsmittel), zum anderen fehle das Geld, um Talente in die
Hauptstadt zu holen. So konzentriert sich weiterhin alles um die 6, 7 Hauptstadtclubs,
die auch die Nationalmannschaft bilden. Viel hängt nun von diesen Elf ab,
wie es mit “Khulbumbug”, wie Fußball auf mongolisch heisst,
in Zukunft weitergeht...
Quellen: Fußball-Weltatlas; Übersteiger; Internet...
Falko